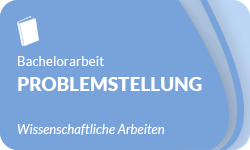
Die Problemstellung der Bachelorarbeit ist der inhaltliche Kern deiner wissenschaftlichen Arbeit. Sie definiert, worum es in der Arbeit geht, warum das Thema relevant ist und welchen Beitrag du zum Forschungsstand leisten willst. Ist die Problemstellung unklar oder wenig aussagekräftig, wirkt sich das negativ auf die Bewertung aus. In diesem Beitrag erfährst du, wie du eine Problemstellung für deine Bachelorarbeit Schritt für Schritt entwickelst.
Definition: Problemstellung der Bachelorarbeit
In einer Bachelorarbeit und anderen wissenschaftlichen Arbeiten beschreibt die Problemstellung das Thema, die Relevanz und das Ziel der Untersuchung. Sie bildet den thematischen Rahmen deiner Bachelorarbeit und stellt den Bezug zur Forschungslücke her. Eine gute Problemstellung ist spezifisch, relevant und in deinem Studienkontext sinnvoll begründet.
Notwendigkeit
Die Problemstellung deiner Bachelorarbeit ist kein unnötiger Formalakt. Sie ist das Fundament deiner ganzen Arbeit. Ohne sie fehlt dir der rote Faden, der deine Argumentation zusammenhält. Die Problemstellung beantwortet die zentralen Fragen:
„Worum geht es in deiner Arbeit eigentlich und warum ist das relevant?“
Schon an der Problemstellung erkennt man, ob deine Arbeit das Potenzial hat, wissenschaftlich zu überzeugen. Zeigst du hier klar, was du untersuchst, warum das Thema wichtig ist und wie du vorgehst, machst du Prüfende neugierig und hast von Anfang an einen Vorteil.
Die Problemstellung deiner Bachelorarbeit muss so gewählt sein, dass du sie im Rahmen von 40 bis 70 Seiten (je nach Hochschule) sinnvoll bearbeiten kannst; nicht zu groß, nicht zu klein.
An diesen vier Kriterien erkennst du eine gute Problemstellung:
- Relevanz: Das Thema hat eine fachliche Bedeutung
- Aktualität: Es bezieht sich auf gegenwärtige Diskussionen
- Machbarkeit: Der Umfang ist realistisch für deinen Zeit- und Seitenrahmen
- Angemessenheit: Es passt zum wissenschaftlichen Anspruch einer Bachelorarbeit
Erfüllst du diese Punkte, hast du bereits ein starkes Fundament für den weiteren Schreibprozess gelegt und die halbe Arbeit (im Kopf) ist schon gemacht.
Titel & Problemstellung
Titel und Problemstellung der Bachelorarbeit hängen eng zusammen, aber sie sind nicht dasselbe. Viele Studierende gehen den falschen Weg und denken zuerst an einen schicken Titel. Doch: Der Titel ergibt sich aus der Problemstellung, nicht umgekehrt.
Was ist der Titel der Bachelorarbeit?
Der Titel ist eine komprimierte Kurzfassung deiner Problemstellung. Er macht klar, worum es in deiner Bachelorarbeit geht und sollte dabei informativ, konkret und präzise formuliert sein.
Was ist die Problemstellung der Bachelorarbeit?
Die Problemstellung beschreibt das inhaltliche Problem, das du untersuchst, inklusive Kontext, Relevanz und Zielrichtung. Sie ist der thematische Ausgangspunkt deiner gesamten Arbeit.
Wie hängen Problemstellung und Titel zusammen?
- Du formulierst zuerst die Problemstellung, dann den Titel.
- Der Titel basiert auf der Problemstellung, nicht umgekehrt.
- Ein guter Titel fasst deine Frage/dein Untersuchungsziel in einem Satz zusammen.
- Er sollte den Lesenden zeigen, worauf sie sich in der Arbeit einstellen können, ohne unnötig allgemein zu sein.
Schreibe nicht den Titel zuerst, sondern starte mit der Problemstellung. Der Titel ergibt sich später fast automatisch.
Beispiele
Damit du den Unterschied zwischen Problemstellung und Titel besser verstehst, zeigen wir dir ein paar Beispiele aus verschiedenen Fachbereichen. So siehst du, wie sich aus einer konkreten Problemstellung ein passender Titel ableiten lässt.
BWL
Viele Unternehmen werben mit nachhaltigen Produkten, obwohl diese häufig nicht den Erwartungen der Kundschaft entsprechen. Dieses sogenannte Greenwashing kann langfristig das Vertrauen schädigen. Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen von Greenwashing auf das Markenimage zu untersuchen.
Welchen Einfluss hat Greenwashing auf das Kaufverhalten der Generation Z?
Greenwashing im Marketing – Einfluss auf Markenbild und Kaufverhalten
Soziologie
Streaming-Serien greifen zunehmend gesellschaftspolitische Themen wie Gendergerechtigkeit oder Vielfalt auf. Gleichzeitig entstehen im Netz Diskussionen, von Zustimmung bis zu „Cancel Culture“-Vorwürfen. Die Arbeit analysiert den Einfluss solcher Serien auf die gesellschaftliche Meinungsbildung.
Wie wirken politisch aufgeladene Serieninhalte auf das Meinungsklima in sozialen Medien?
Zwischen Aktivismus und Shitstorm – Gesellschaftliche Reaktionen auf Diversität in Streaming-Serien
Psychologie
Trotz wachsender Achtsamkeitsbewegung zeigen aktuelle Studien, dass viele Studierende unter chronischem Stress leiden. Besonders in der Prüfungsphase nehmen Symptome wie Schlaflosigkeit, Gereiztheit und Motivationsverlust zu. Die Ursachen sind jedoch nur unzureichend untersucht, insbesondere in Bezug auf digitale Ablenkung im Alltag.
Wie beeinflussen digitale Medien das Stresslevel von Studierenden in der Prüfungszeit?
Digitale Ablenkung und Prüfungsstress – Eine Untersuchung zur Stresswahrnehmung bei Studierenden
Bildungswissenschaft
Der Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht hat sich seit der Corona-Pandemie stark verändert. Viele Lehrkräfte fühlen sich überfordert, gleichzeitig steigt der Druck zur Digitalisierung. Die Arbeit untersucht, welche Kompetenzen Lehrende für digitalen Unterricht benötigen und ob diese im Lehramtsstudium ausreichend vermittelt werden.
Wie gut bereitet das Lehramtsstudium auf digitalen Unterricht vor?
Digitale Kompetenzen im Lehrerberuf – Eine Analyse der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte
Formulierung
Du weißt, worüber du schreiben willst, aber weißt nicht, wie du das in eine wissenschaftliche Problemstellung gießen sollst? Hier zeigen wir dir ganz konkret, wie du die Problemstellung deiner Bachelorarbeit in fünf einfachen Schritten formulierst.

Schritt 1: Was interessiert dich wirklich?
Bevor du etwas formulierst, frag dich:
- Was finde ich spannend?
- Was regt mich zum Nachdenken an?
- Was würde ich gern besser verstehen?
Du wirst viel Zeit mit deiner Bachelorarbeit verbringen. Also wähle ein Thema, das dich wirklich interessiert.
Schritt 2: Gibt es dazu schon was?
Jetzt geht es in die Literatur:
- Recherchiere Bücher, Fachartikel oder Studien zu deinem Thema.
- Was wurde schon erforscht und was nicht?
- Gibt es offene Fragen oder Widersprüche?
→ Ziel: Einen Überblick gewinnen und eine Forschungslücke finden.
Schritt 3: Lücke entdecken = Thema finden
Wenn du im Forschungsstand etwas findest, das bisher nicht ausreichend beantwortet wurde, hast du die Problemstellung deiner Bachelorarbeit fast schon in der Hand. Frag dich:
- Was wird aktuell in deinem Fach diskutiert?
- Wo kannst du einen sinnvollen Beitrag leisten?
- Wo gibt es Unsicherheiten oder offene Fragen?
Schritt 4: Lücke in Worte fassen
Jetzt formulierst du die Problemstellung deiner Bachelorarbeit:
- Was ist das Problem, das du untersuchst?
- Warum ist es relevant?
- Welche Frage ergibt sich daraus?
Tipp: Denk nicht an „blumige“ Sprache. Schreib sachlich, klar und direkt.
Schritt 5: Thema & Titel ableiten
Die Forschungsfrage deiner Bachelorarbeit ergibt sich logisch aus der Problemstellung. Daraus wiederum kannst du einen prägnanten Titel basteln.
So hängen diese Dinge zusammen:
Titel
Komprimierte Zusammenfassung deiner Frage
Forschungsfrage
Formuliert, was genau du untersuchen willst
Problemstellung
Beschreibt das Problem und den Kontext
Beispiele
Du hast ein Thema, das dich interessiert, aber wie machst du daraus eine Problemstellung für deine Bachelorarbeit? Hier zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du von einem persönlichen Interesse zu einem relevanten Thema über die Problemstellung, zur Forschungsfrage und Teilfragen kommst.
Interesse → Recherche → Problemstellung → Forschungsfrage → Teilfragen
Dein Interesse als Ausgangspunkt
Nehmen wir an, du bist Fan der neueren Star Trek Serien (Picard, Discovery, Strange New Worlds) an. Beim Schauen fällt dir auf, dass aktuelle gesellschaftliche Themen wie Veganismus, LGBTQ+, Gleichberechtigung und Achtsamkeit deutlich in den Vordergrund rücken.
Online stößt du auf deutliche Kritik. Viele lehnen diese Darstellungen ab oder sprechen von „Wokeness“. Du beginnst zu recherchieren: Steckt dahinter ein gesellschaftlicher Konflikt?
Du beginnst zu recherchieren
Du liest erste Artikel, durchforstest Fachliteratur und Diskussionen in Medienwissenschaft und Soziologie. Dabei entdeckst du eine Lücke: Es gibt zwar viele Meinungen, aber kaum fundierte wissenschaftliche Untersuchungen, wie die sogenannte Woke-Bewegung die filmische Darstellung von Rassismus beeinflusst hat.
Das bringt dich zur zentralen Überlegung deiner Arbeit: Was hat sich in Hollywood wirklich verändert?
Die Problemstellung entsteht
Jetzt formulierst du das eigentliche Problem:
Damit ist deine Problemstellung der Bachelorarbeit klar definiert: Du beschreibst, was du untersuchen willst, warum das relevant ist und wo der wissenschaftliche Mehrwert liegt.
Die Forschungsfrage ergibt sich daraus
Aus deiner Problemstellung entwickelst du die zentrale Forschungsfrage:
Diese Frage ist präzise, relevant und innerhalb einer Bachelorarbeit bearbeitbar.
Du entwickelst Teilfragen
Um deine Forschungsfrage sinnvoll zu bearbeiten, brauchst du Unterfragen, die dir helfen, das Thema systematisch zu durchdringen:
- Was ist die sogenannte Woke-Bewegung, und welche Ziele verfolgt sie?
- Was versteht man unter Rassismus und speziell systemischem Rassismus?
- Wie äußert sich Rassismus in der Filmindustrie, insbesondere in Hollywood?
- Welche Veränderungen lassen sich in aktuellen Serien und Filmen beobachten?
- Gibt es Hinweise auf einen echten Wandel – oder ist alles nur „Diversity-Washing“?
Diese Teilfragen bilden die Grundlage für den Aufbau und Gliederung deiner Bachelorarbeit. Du arbeitest diese einzeln ab und beantwortest am Ende die zentrale Forschungsfrage.
Vom Serienfan zur Problemstellung
Aus einem popkulturellen Interesse wird durch gezielte Recherche und kritische Reflexion ein wissenschaftliches Thema. Und daraus entsteht wiederum eine konkrete Problemstellung für deine Bachelorarbeit. Der Weg dahin ist logisch, machbar und oft überraschend spannend.
Tipps
Du hast jetzt verstanden, was die Problemstellung deiner Bachelorarbeit leisten muss, aber wie bleibst du dabei klar im Kopf, im Thema und im Zeitplan?
Hier kommen ein paar Tipps, damit dir die Formulierung leichter fällt und du nicht unterwegs den Faden verlierst.
💬 Sprich mit deiner Betreuungsperson
Bevor du dich verrennst, hol dir früh Feedback.
- Frag deinen betreuenden Professor oder deine Professorin, ob deine Problemstellung Bachelorarbeit machbar, relevant und passend ist.
- Du bekommst nicht nur eine Rückmeldung, sondern meist auch wertvolle Hinweise auf Fachliteratur oder Studien, die du vielleicht bisher nicht kennst.
📌 Bleib beim roten Faden
Lass dich nicht ablenken – auch nicht von deinem eigenen Enthusiasmus.
- In der Recherchephase wirst du viele spannende Aspekte entdecken. Aber: Bleib bei einer Problemstellung.
- Alles, was thematisch daneben liegt, erwähnst du nur am Rand und kehrst dann zurück zu deiner Kernfrage.
🧠 Plane feste Arbeitszeiten ein
Deine Konzentration ist hier wirklich gefragt.
- Die Formulierung der Problemstellung deiner Bachelorarbeit verlangt Fokus, vor allem, wenn du Literatur sichtest und Inhalte sinnvoll eingrenzt.
- Plane dafür feste Zeitfenster ein, am besten ohne andere Abgaben oder Seminare im Nacken.
✅ Fazit: Es lohnt sich
Eine sauber formulierte Problemstellung spart dir im späteren Schreibprozess Zeit, Nerven und verbessert deine Note. Nimm dir also die Zeit, diesen Teil deiner Arbeit wirklich sorgfältig zu durchdenken. Du wirst es dir selbst danken.
Checkliste
Damit du beim Formulieren deiner Problemstellung für die Bachelorarbeit nichts vergisst, haben wir dir alle wichtigen Punkte in einer übersichtlichen Checkliste zusammengestellt. Du kannst sie dir hier ganz einfach als PDF oder Word-Datei herunterladen.
Häufig gestellte Fragen
Sie sollte zu deinem Studienfach passen, dich interessieren und eine erkennbare Relevanz für die Forschung oder Praxis haben.
Die Problemstellung einer Bachelorarbeit beschreibt das zentrale Problem oder Thema, das in der Arbeit untersucht wird, und erklärt, warum es relevant ist.
Sie ist relevant, wenn ihre Bearbeitung neue Erkenntnisse liefert. Frag im Zweifel deine Betreuungsperson um Einschätzung.
Nur wenn du beim Schreiben feststellst, dass eine tieferliegende Fragestellung sinnvoller ist und die ursprüngliche mit abdeckt.
Auch das ist ein Ergebnis: Wenn sich ein Problem mit wissenschaftlichen Mitteln nicht lösen lässt, ist das eine zulässige Erkenntnis.
Nein. Eine Bachelorarbeit sollte sich immer auf eine zentrale Problemstellung konzentrieren. Teilfragen sind erlaubt, aber kein Themawechsel.